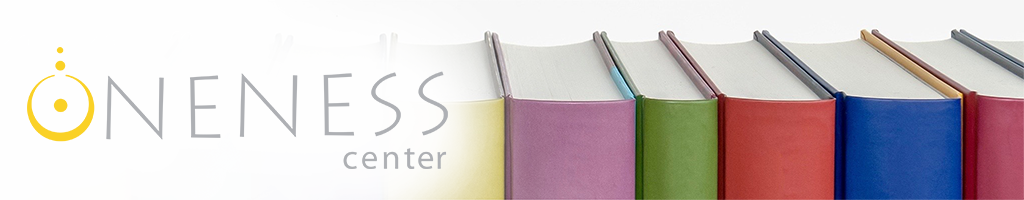Leseprobe aus "Das Lächeln der Senoi"
...Heutzutage haben die Menschen viele Namen: einen Vornamen, einen Nachnamen, oft einen zweiten Vornamen, eine Bezeichnung als Staatsangehöriger und andere mehr. Die Staatsangehörigkeit verrät manchmal etwas über die ethnische Zugehörigkeit. Doch Staaten, deren Grenzen politischer Natur sind und nichts mit kultureller, sprachlicher oder ethnischer Zugehörigkeit zu tun haben, umfassen gewöhnlich eine kunterbunte Mischung von Menschen, die sich zufälligerweise innerhalb dieser erdachten Linien befanden, die man bei der Staatsgründung auf einer Karte einzeichnete. Deshalb haben wir das Bedürfnis, Namen zu erfinden, die besser beschreiben, wer wir sind. Wir nennen uns selbst amerikanische Ureinwohner, Afro-Amerikaner, irischkatholische Amerikaner, Quäker, Mormonen, Amische. Oder wir wählen Bezeichnungen, die uns aufgrund der Region eine Identität geben: Südstaatler, Kalifornier.
Es gibt noch einige wenige überlebende Völker auf der Erde, die aus einer Zeit stammen, in der diese Unterschiede nicht existierten. Sie sehen sich selbst als das Volk, und sie bezeichnen sich mit dem Wort, das in ihrer jeweiligen Sprache Mensch bedeutet.
Zur damaligen Zeit erkannte eine neue Verfassung in Malaysia drei Gruppen von Bürgern an, genauer: drei verschiedene Ethnien. Die Rangfolge dieser drei Volksgruppen entsprach mehr oder weniger der zeitlichen Abfolge ihrer Einwanderung in das heutige Malaysia. Die frühen Einwanderer besaßen mehr Rechte als jene, die später kamen. Die Malaien hielt man für die ersten, obwohl die Ureinwohner ganz sicher vor ihnen im Land ansässig waren. Die Malaien nannte man orang kebangsaan (Das Volk der Nation); die Ureinwohner nannte man höfl ich orang asli (die Vorfahren) oder, im allgemeinem Sprachgebrauch, sakai (Sklaven).
Die meisten Malaien hatten wahrscheinlich vergessen, dass das Wort, mit dem sie dieses seltsame, ursprüngliche, sehr schüchterne Volk bezeichneten, das tief im Dschungel der Berge (Sakai) lebte, Sklave bedeutete. Sie dachten selten über diese Dschungelbewohner nach, die kaum Kleider trugen und die man selten zu Gesicht bekam. Tatsächlich waren die Sakai, die Sklaven, ein nahezu mythisches Volk; und es gab nur wenige Malaien, die ihnen jemals begegnet waren.
Nachdem ich die Sng’oi, die Menschen, besser kennengelernt hatte und von ihnen akzeptiert wurde, entschuldigte ich mich dafür, sie – bevor ich wusste, wie sie sich selbst nannten – als Sklaven bezeichnet zu haben.
Wir saßen früh am Abend um die Glut eines kleinen Feuers herum. Eine flackernde Öllampe warf etwas Licht auf die Veranda einer der kleinen Behausungen. In dieser Siedlung gab es vier Häuser; nicht mehr als fünfzehn Menschen lebten hier. Wenn die Sonne unterging, saßen wir da, redeten ab und zu und waren vor allem einfach beisammen.
Ich hatte ihre Sprache ein wenig sprechen gelernt und versuchte zu verstehen, was sie sagten, doch fließend sprechen konnte ich nie wirklich. Meine Entschuldigung bestand aus einem ein Sklaven fachen Satz. Ich sagte, ich hoffe, es mache ihnen nichts aus, dass ich sie Sakai genannt hatte. Ich war mir nicht sicher, ob ich es richtig gesagt hatte, und lange Zeit erwiderte niemand etwas.Ich hatte den Eindruck, auf einigen Gesichtern sei ein Lächeln zu sehen, doch es war dunkel. Ich konnte mich getäuscht haben. Langes Schweigen war für sie nichts Besonderes. Oft sagte jemand etwas, woraufhin alle schwiegen, bis schließlich jemand anderes antwortete. Diese eine Person sprach dann offensichtlich für die ganze Gruppe, doch wunderte ich mich oft, wieso er oder sie wusste, was im Namen der Gruppe zu sagen war.
Auch diesmal antwortete jemand. Es war ein ziemlich abenteuerlustiger, junger Mann, wie man mir später sagte, und er sprach – wohl mir zuliebe – langsam und einfach: »Nein«, erwiderte er, »es macht uns nichts aus, wenn die anderen uns Sakai nennen. Wir schauen uns die Menschen da unten an. Sie müssen zu einer bestimmten Zeit am Morgen aufstehen, sie müssen alles mit Geld bezahlen, das sie verdienen müssen, indem sie für andere Leute Dinge tun. Man sagt ihnen fortwährend, was sie tun und was sie lassen sollen.« Er hielt inne und fügte dann hinzu : »Nein, es macht uns nichts aus, wenn sie uns Sklaven nennen.«
Über den Autor:
Robert Wolff lebt in Hawaii. Er schreibt Bücher, Geschichten, Essays über die Natur: »Ich schreibe über alle Lebewesen und alles, was mich umgibt und zu dem ich in Beziehung stehe: über das Federvolk, die Vierbeiner und Zweibeiner, über Bäume, Pflanzen, Samen und Stürme, über Sonne, Wind und Regen. Über die faszinierende Schönheit des Chaos Natur, dem unendlichen Wechselspiel, in dem alles mit allem verbunden ist. Fakten? Hier geboren, dort gelebt, andernorts gearbeitet, verheiratet, Kinder, Großkinder, Urgroßkinder, Abschlüsse, Begegnungen, Enttäuschungen. Ja, all das – ich bin alt. Ich hatte ein aufregendes Leben, reiste viel, lebte in verschiedenen Ländern, spreche einige Sprachen und je älter ich werde, desto mehr fasziniert mich das Einfache.«